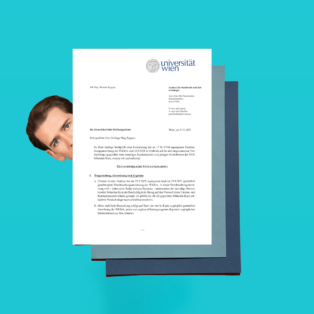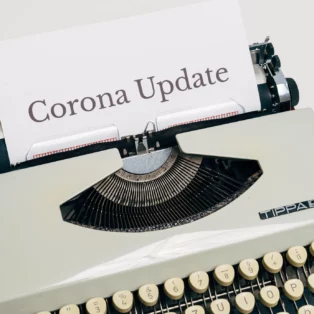Die Nationalratswahl 2024 ist geschlagen, das Ergebnis vielfach analysiert. Die aktuelle Wählerstromanalyse zeigt, welche Parteien von den jeweils anderen politischen Lagern Stimmen lukrieren konnten – oder an sie verloren haben. Ein nicht zu vernachlässigendes Segment ist dabei jenes Nichtwähler:innen. Über 1,4 Millionen wahlberechtigte Personen haben bei der Nationalratswahl kein Kreuzerl gemacht.
Seit 1945 ist die Wahlbeteiligung rückläufig, die letzten Nationalratswahlen hatten in etwa 75-80% Wahlbeteiligung.
Dabei wurde im Vorfeld wochenlang intensiv – teilweise sogar von Unternehmen – dafür geworben, sich für die Demokratie „einzusetzen“. „Wählen ist wie Zähneputzen: Macht man’s nicht, wird’s braun“, so das Credo, das vor allem in sozialen Medien zigfach geteilt und so zur Stimmenabgabe motivieren sollte.
Und auch wenn wohl die wenigsten Menschen bewusst aufs Zähneputzen verzichten, so gab es auch bei dieser Nationalratswahl Menschen, die bewusst auf das Wählen verzichtet haben. Auf Instagram finden sich Beiträge von Personen, in denen sie erklären, weshalb sie nicht zur Wahl gegangen sind – und das obwohl sie sich für Politik interessieren. Ein Grund dafür ist die prinzipielle Ablehnung des Systems „Demokratie“. Alle fünf Jahre zum Wählen aufgerufen zu werden sei zu wenig, heißt es da beispielsweise. So zeichnet sich das Nicht-Wählen im Spektrum der Protestwähler*innen ab, frei nach dem Motto
Keine Antwort ist auch eine Antwort
Was ist Demokratieskepsis?
Kritik am politischen System der Demokratie ist dabei nicht automatisch als „Demokratieskepsis“ zu verstehen. Die Wissenschafts- und Demokratieskepsis wird in einer aktuellen Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) immerhin als „grundsätzliche und unbegründete bzw. ungerechtfertigte Ablehnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen“ definiert. Das Spektrum der negativen Grundhaltung umfasst neben der Skepsis auch das Desinteresse und die Kritik, wobei besonders letztere eine wichtige Rolle spielt. Denn die Kritikfähigkeit sei prinzipiell im Sinne einer aufgeklärten Gesellschaft und auch für den wissenschaftlichen Betrieb essenziell, so die Studienautoren.
Das Vertrauen in Wissenschaft und die Zufriedenheit mit der Demokratie werden von Faktoren wie Populismusaffinität oder Demokratieverständnis ähnlich beeinflusst, so die Erkenntnis des IHS.
„Personen, die Parteien als das Hauptproblem des Landes identifizieren, direkte Volksentscheide der repräsentativen Demokratie vorziehen und eine starke Führungspersönlichkeit an der Spitze installiert sehen möchten, die nicht durch Parlament und Wahlen beschränkt wird und politische Entscheidungen allein trifft, vertrauen Wissenschaft weniger und sind mit der Demokratie unzufriedener“, heißt es folglich im IHS-Bericht.
Weiters würden die Befragten wenig zwischen Wissenschaftler*innen und Politiker*innen unterscheiden, da beide als „Repräsentant*innen privilegierter Gruppen“ wahrgenommen werden.
Höhere Bildung, höheres Vertrauen
Das aktuelle Eurobarometer hält fest, dass 53% der Österreicher*innen der Aussage „Kenntnisse über Wissenschaft und Forschung zu besitzen, ist für mein tägliches Leben nicht von Bedeutung“ zustimmen. Zum Vergleich: Im EU-Schnitt stimmen dieser Aussage nur 33% zu. Und laut IHS-Studie würden zehn Prozent der befragten Österreicher*innen eine grundlegende Skepsis gegenüber Wissenschaft und Demokratie an den Tag legen. Dieser zehn Prozent sind dabei keinem sozialen Milieu zuzuordnen – wissenschafts- und demokratieskeptische Personen finden sich in allen Bevölkerungsgruppen wieder.
Eine ablehnende Haltung könne unter anderem von jungem Alter, niedrigem Bildungsniveau, Unzufriedenheit mit der Demokratie und der Orientierung am rechten politischen Spektrum begünstigt werden, so die Studienautoren des IHS. Die Ergebnisse seien aber nicht eindeutig genug, um diese Faktoren als alleinige Ursachen der Skepsis zu ernennen, heißt es. Wenn es um die Bildung geht, findet man im aktuellen Wissenschaftsbarometer jedoch eindeutige Worte: „Je höher die formale Bildung der Befragten ist, desto höher ist auch das Vertrauen“ (Österreichische Akadamie der Wissenschaften, 2022).
Die formale Bildung wiederum wird in Österreich vererbt. Wer Akademiker als Eltern hat, kann besser von diesen beim Lernen unterstützt werden, geht aus den Daten des Nachhilfebarometers der Arbeiterkammer hervor. Das untermauern auch die Ergebnisse der Statistik Austria: 57% der Kinder mit Akademiker-Eltern schließen ebenfalls ein Studium ab. Unter den Kindern deren Eltern einen Pflichtschulabschluss haben sind es nur 7%.
Politische Bildung für alle?
Die Skepsis gegenüber der Demokratie wird also von vielen verschiedenen Faktoren begünstigt und hängt eng mit dem Wissenschaftsverständnis und der Bildung einer Person zusammen. Sie äußert sich auf verschiedene Weise, etwa in der Enthaltung bei demokratischen Prozessen wie der Nationalratswahl. Die gute Nachricht ist aber: „Viele Personen, die Kritik an Wissenschaft und Demokratie äußern, lehnen diese Bereiche nicht systematisch und unbegründet ab und können daher auch im Dialog erreicht werden“, so die Studienautoren des IHS. Voraussetzung dafür sei jedoch die Schaffung von Räumen, in denen dieser Dialog stattfinden könne, heißt es.
Um diesen Dialog zu ermöglichen, gibt es Projekte wie die „Demokratiewerkstatt“. Damit sollen jungen Menschen politische und mediale Prozesse nähergebracht werden. Eine weitere Initiative ist YEP, kurz für „Youth empowerment participation“, und ist ebenso für junge Menschen gedacht, die sich für Politik interessieren und sich politisch engagieren wollen. Geht es um gezielte Maßnahmen, sollte der Fokus allerdings nicht ausschließlich auf der jungen Bevölkerung liegen, sondern auch verstärkt in Richtung Erwachsenenbildung gehen.
Bei der Nationalratswahl 2019 waren immerhin genauso viele Pensionist*innen nicht wählen wie bei den unter-30-jährigen, hielt unlängst Politologe Peter Filzmaier in der Sendung „Im Zentrum“ fest. Wählen und Zähneputzen gehen ist eben auch im hohen Alter noch von Bedeutung.